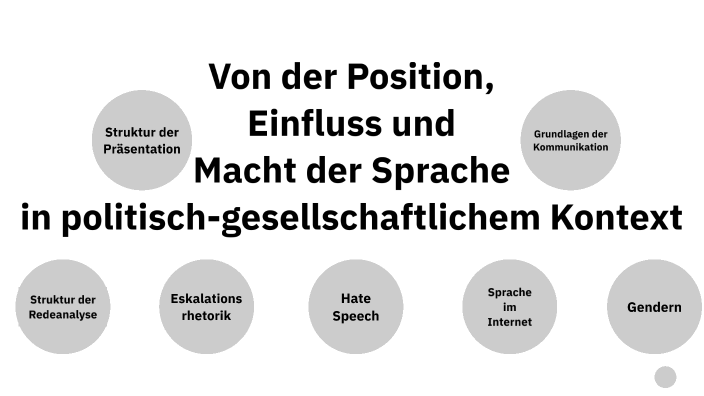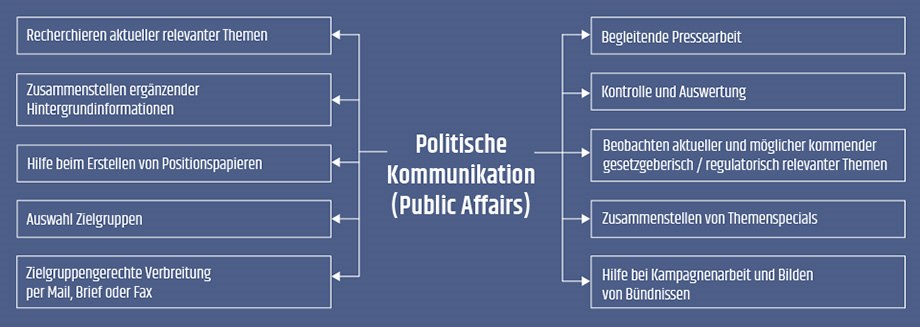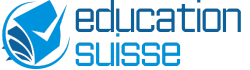Sprachliche Merkmale Politisch-gesellschaftlicher Kommunikation

Kennt ihr das, wenn ihr in einer hitzigen Diskussion über das neueste politische Debakel landet und plötzlich das Gefühl habt, alle reden aneinander vorbei? Neulich saß ich beim Abendessen mit Freunden, und es ging um die Klimapolitik. Lisa warf mit Fachbegriffen um sich, Peter schimpfte nur über "die da oben", und ich versuchte, den Überblick zu behalten, während ich mir heimlich ein weiteres Stück Pizza schnappte. Irgendwie hatten wir alle Recht, aber irgendwie auch nicht. Das Ganze hat mich zum Nachdenken gebracht: Was macht eigentlich die Sprache in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen so besonders – und manchmal so frustrierend?
Tja, die sprachlichen Merkmale politisch-gesellschaftlicher Kommunikation sind ein weites Feld. Aber keine Angst, wir werden uns hier nicht in trockener Linguistik verlieren. Vielmehr wollen wir mal schauen, wie bestimmte sprachliche Kniffe und Tricks benutzt werden, um Meinungen zu formen, zu manipulieren (ups, hab ich das laut gesagt?) und letztendlich die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Bist du bereit für eine kleine Entdeckungsreise?
Framing: Die Macht der Perspektive
Ein ganz wichtiger Punkt ist das sogenannte Framing. Stell dir vor, du betrachtest ein Bild durch einen Rahmen. Der Rahmen lenkt deinen Blick und betont bestimmte Aspekte. Genauso ist es mit der Sprache. Durch die Wortwahl und die Art, wie Informationen präsentiert werden, können politische Akteure ein Thema in einem bestimmten Licht erscheinen lassen. Denk mal an die Diskussion über Migration: Spricht man von "Flüchtlingswelle" oder von "Menschen in Not"? Beide Begriffe beschreiben im Grunde dasselbe, aber sie rufen völlig unterschiedliche Assoziationen hervor, oder? Und genau das ist der Punkt!
Kleiner Tipp: Wenn du das nächste Mal eine Nachricht liest oder eine politische Rede hörst, frag dich: Welchen Rahmen verwendet der Sprecher/Autor hier? Was wird betont, was wird ausgeblendet?
Euphemismen und Dysphemismen: Beschönigen vs. Verteufeln
Politiker sind Meister darin, Dinge schönzureden oder eben zu verteufeln. Euphemismen sind beschönigende Ausdrücke, die unangenehme Wahrheiten kaschieren sollen. "Kollateralschaden" für tote Zivilisten im Krieg ist ein klassisches Beispiel. Oder "leistungsgerechte Anpassung" statt Gehaltskürzung. Klingt doch gleich viel freundlicher, nicht wahr? (Ironie off, natürlich!).
Dysphemismen hingegen sind abwertende Ausdrücke, die dazu dienen, etwas oder jemanden in ein schlechtes Licht zu rücken. "Lügenpresse" ist ein bekanntes Beispiel dafür. Solche Begriffe sind oft emotional aufgeladen und sollen die Zuhörer oder Leser manipulieren.
Achtung: Sowohl Euphemismen als auch Dysphemismen sind oft ein Zeichen dafür, dass jemand versucht, die Wahrheit zu verdrehen oder zumindest zu verschleiern.
Rhetorische Figuren: Sprachliche Spielereien
Metaphern, Vergleiche, Ironie, rhetorische Fragen... die Liste ist lang! Politische Reden sind voll von rhetorischen Figuren. Sie dienen dazu, Botschaften einprägsamer zu machen und Emotionen zu wecken. Eine gut gewählte Metapher kann komplexe Sachverhalte veranschaulichen und im Gedächtnis bleiben. Aber Vorsicht! Auch hier gilt: Rhetorische Figuren können auch dazu benutzt werden, zu täuschen oder zu manipulieren. Denk an den Vergleich von Migranten mit einer "Flut". Eine Flut ist etwas Bedrohliches, Unkontrollierbares – und genau diese Assoziation soll hier erzeugt werden.
Merke: Rhetorische Figuren sind ein zweischneidiges Schwert. Sie können die Kommunikation bereichern, aber auch missbraucht werden.
Der Kampf um die Deutungshoheit
Letztendlich geht es in der politischen und gesellschaftlichen Kommunikation immer um die Deutungshoheit. Wer bestimmt, wie ein bestimmtes Ereignis oder Thema interpretiert wird? Wer legt die Definitionen fest? Diejenigen, die die Deutungshoheit haben, haben auch die Macht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und wer hat die Deutungshoheit? Oft sind es die Medien, die politischen Eliten, aber auch Influencer und Aktivisten. Der Kampf um die Deutungshoheit ist ein ständiger Wettbewerb, bei dem es darum geht, die eigene Sichtweise durchzusetzen. Also, sei kritisch, hinterfrage, und lass dich nicht von der Sprache manipulieren! Denk daran, die Pizza ist auch nur so gut wie ihre Zutaten. Und bei politischen Aussagen gilt das noch viel mehr!