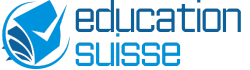Woher Kommt Das Lied In Einem Polenstädtchen

Wisst ihr, ich war letztens auf einem etwas...nun ja, sagen wir, lebhaften Geburtstag. Irgendwann kam ein Akkordeon zum Vorschein, und plötzlich sang die ganze Gesellschaft lauthals ein Lied. "In einem Polenstädtchen…" – ich kannte es vage, aber woher kam das bloß? Und was hat es mit diesem Städtchen eigentlich auf sich? Hat es überhaupt existiert? Fragen über Fragen! Da dachte ich mir, das muss ich mal recherchieren. Vielleicht geht es euch ja auch so, und ihr habt euch das schon immer gefragt. Also los!
Also, "In einem Polenstädtchen," das ist so ein Lied, das kennt irgendwie jeder, oder? Egal ob Oma, Opa, oder der seltsame Nachbar, der immer nur "Wickie" guckt – irgendwann hat's jeder mal gehört. Aber die wenigsten wissen, woher es eigentlich kommt. Ist ja auch typisch, oder? Man singt etwas mit, ohne zu wissen, was man da eigentlich so von sich gibt. #typischdeutsch
Die Faktenlage: Eine musikalische Wanderung
Das Lied selbst ist eine Bearbeitung eines jüdischen Volksliedes. Genauer gesagt, es basiert auf dem Lied "Oyfn Pripetchik" (Auf dem Ofen). Das kennt ihr vielleicht auch? Wahrscheinlich nicht direkt, aber es gibt viele Versionen und Ableger. "Oyfn Pripetchik" ist ein jiddisches Lied, das von Mark Warshawsky geschrieben wurde. Und jetzt kommt der Clou: Es wurde vermutlich 1898 geschrieben. Krass, oder? So alt ist das Ding!
Das Lied erzählt von einem Rabbi, der Kinder das hebräische Alphabet lehrt. Ist also eigentlich ein Bildungs-Song. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man die Version mit dem Polenstädtchen kennt, oder? Die ist ja doch etwas...fröhlicher, sagen wir mal. Und weniger rabbinisch.
Irgendwann, irgendwann im Laufe der Zeit, hat dann jemand gedacht: "Hey, das ist eine super Melodie, aber der Text...der ist mir zu jüdisch." (Achtung, Ironie!) Und dann wurde es eben "eingedeutscht." Und zwar nicht gerade sensibel. #geschichtsbewusstseinbitte
Das "Polenstädtchen": Eine Problematische Metamorphose
Der Text von "In einem Polenstädtchen" ist...wie soll ich sagen...stereotypisch. Es bedient sich an Klischees und Vorurteilen über Juden in Osteuropa. Und das ist natürlich problematisch. Sehr problematisch. Klar, es mag sein, dass der Text nicht unbedingt böswillig gemeint ist, aber die Wirkung ist trotzdem nicht ohne.
Und genau hier liegt der Knackpunkt. Ein wunderschönes, ursprünglich jüdisches Lied wird durch eine Bearbeitung zu etwas, das zumindest kritisch zu hinterfragen ist. Man muss sich also bewusst sein, was man da eigentlich singt. Nur weil ein Lied fröhlich klingt, heißt das nicht, dass es auch harmlos ist. Habt ihr das verstanden? Gut!
Es gibt übrigens verschiedene Versionen von "In einem Polenstädtchen." Manche sind harmloser, manche weniger. Manche enthalten Passagen, die man wirklich lieber nicht singen sollte. Also, Augen auf beim Liederkauf! Oder besser gesagt, beim Mitsingen!
Was lernen wir daraus?
Tja, was lernen wir daraus? Erstens, dass man sich immer fragen sollte, woher ein Lied eigentlich kommt. Und zweitens, dass man sich bewusst sein sollte, was man da singt. Einfach blindlings irgendwelche Texte nachplappern, ist keine gute Idee. #thinkbeforeyousing
Und drittens: Man kann auch einfach die Originalversion "Oyfn Pripetchik" singen. Ist auch schön und hat eine viel bessere Botschaft. Oder man lässt es ganz bleiben und summt einfach nur die Melodie. Das ist auch eine Option!
So, jetzt wisst ihr Bescheid. Nächstes Mal, wenn ihr "In einem Polenstädtchen" hört, könnt ihr mit eurem Wissen glänzen. Oder euch einfach nur denken: "Ohje, nicht schon wieder!" Aber wenigstens wisst ihr jetzt, woher das Lied kommt und warum man es vielleicht nicht unbedingt mit voller Inbrunst mitsingen sollte. Denn, ganz ehrlich, so fröhlich wie es klingt ist es eben nicht.